Anfänger?
Lehrer Schüler Fliegen – so geht´s

Ein Multicopter mit feinjustierter Flight Control, fliegt sich nicht nur sehr smooth, er lässt sich auch recht einfach kontrollieren. Wieso also nicht damit fliegen lernen?
Seit jeher nutzen Modellflieger bei der Ausbildung Lehrer-/Schülerbetrieb eines Modells. Dabei hat sowohl der „Schüler“ als auch der „Lehrer“ die Möglichkeit, das Modell zu steuern. Der Lehrer kann per Knopfdruck bestimmen, wer die Kontrolle übernimmt. Bevor ein Unfall passiert, kann so jederzeit der erfahrenen Pilot eingegriffen. Heutzutage ist aber nicht nur ein Wechsel der Kontrolle möglich, auch einzelne Funktionen beziehungsweise Achsen können separat an den Schüler übergeben werden. Auf diese Weise sammelt der Schüler Schritt für Schritt Erfahrungen, und der Lernprozess ist mit weniger Stress verbunden.
Doch macht ein Schulungsbetrieb auch mit Multicoptern Sinn? Und wenn ja wie geht man am besten vor?
Findet ein Lehrerschülerbetrieb Berechtigung?
Simulatoren sind kein Novum in der Szene. Es gibt die verschiedensten Preisklassen und Hersteller. In einigen gibt es sogar Multicoptersimulation. Realitätsnahe Simulatoren helfen ebenfalls beim Erlernen des Fliegens. Vorallem, wenn es darum geht, das Umdenken zu erlernen. Was in einem zweidimensionalen System allerdings schwer erlernbar ist, trotz vermeintlicher dreidimensionaler Szenerie ist das Einschätzen von Höhe Geschwindigkeit und Lage. In der Realität hat jeder Multicopter individuelle Flugcharakteristiken. Dazu gehört auch die Silhouette, die bei der Lageerkennung eine große Rolle spielt.
Wer also nachdem er mit dem Simulator erste Erfahrungen gesammelt hat, den teuer erworbenen Multicopter in der Realität ausprobieren möchte, tut gut daran, sich dabei von einem erfahrenen Piloten begleiten zu lassen.
Auch wenn es darum geht, Interessierten den Multicopter näher zu bringen, ist der Lehrer-/Schülerbetrieb hilfreich.
Natürlich lassen sich Ready to Fly-Systeme wie etwa die Phantom-Serie von DJI sehr einfach steuern, trotzdem ist es aus Sicherheitsgründen wichtig, dass der Multicopter auch ohne GPS-Mode und Neigungswinkelbeschränkung beherrscht wird.
Noch ein Vorteil für Einsteiger: Beim Lehrer-/Schülerfliegen haftet der „Lehrer“ im Schadensfall.
Hardware
Drahtlose Systeme, wie zum Beispiel von Multiplex oder Spektrum angeboten, erhöhen den Komfort ungemein. Ein Kabel kann schnell mal beim Laufen übersehen werden. Ich zum Beispiel verwende den Lehrerschülerstick von Multiplex. Dieser wird wie ein normaler Empfänger an die Schülersteuerung gebunden und dann in die Multifunktionsbuchse des Lehrersenders gesteckt. Bei anderen Systemen ist diese Hardware teilweise integriert.
Der Lehrersender ist an den Empfänger des Multicopters gebunden. Das Sendemodul der Lehrerfernsteuerung sendet also entweder die Befehle des Schülersenders oder die eigenen zum Copter. Welches Signal gesendet wird, kann binnen Sekundenbruchteilen per Druckknopf entschieden werden. Praktischerweise wird der Schalter so gewählt, dass die Finger an den Knüppeln bleiben können und man gleichzeitig das Modell immer im Auge hat. Der Lehrerschülerstick kostet den Bruchteil eines Multicopters und rechnet sich somit schnell. Die Anschaffung lohnt sich vor allem auch innerhalb eines Vereins oder einer Interessengemeinschaft.
Und so wird’s gemacht
Der Kern des Multicopters fliegens, liegt im Umdenken und der Lageerkennung. Damit der Schüler das Umdenken konzentriert erlernen kann, bietet es sich an, dass der Lehrer die Höhenregelung (Pitch) übernimmt. Wer zusätzlich noch unterstützen will, übernimmt außerdem noch die Rollachse. Sind die Neigungswinkel begrenzt, kann kaum noch etwas passieren. Als erste Übung dient der einfache Vorwärtsfliegen, eine 180 Grad Kurve und frontales Zurückfliegen. Sobald Anfänger dieses Manöver beherrschen, kann die selbe Übung parallel zu den Piloten durchgeführt werden. Klappen beide Manöver, kann in den Kurven Rollachse und die Höhensteuerung hinzugenommen werden. Einfache Rundflüge sollten zunächst unter fachmännischer Anleitung stattfinden. Zum Beispiel Sinkflüge mit zusätzlicher horizontal Bewegung, um einen Downwash zu vermeiden, schnelle Richtungswechsel unter Einsatz einer Roll- und Drehbewegung um die Hochachse. Sowie Abfangmanöver nach schnellen Flugpassagen, lassen sich mit einem erprobten Piloten als Sicherheit in der Hinterhand einfach erlernen. Wird der Copter beim normalen Rundflug beherrscht, gelingen auch aufwändige Kamerafahrten viel einfacher. Das Fliegen des Multicopters wird allgemein präziser und vielfältiger, wenn man nicht gezwungen ist, GPS-Hold oder ähnliche Flug unterstützende Modi zu verwenden.
Fazit
Ich habe persönlich nur gute Erfahrungen mit dem Schulen von Neulingen und Wiedereinsteigern gemacht. So ist es auch Flugtechnik Fremden möglich, das sichere Fliegen eines Multicopters zu erlernen. Da ein einfacher Zweitsender ausreicht, halten sich die Investitionen in Grenzen und rechnen sich möglicherweise schnell. Ein sicherer Umgang mit Multicoptern sollte im Interesse aller stehen. Ein Einstieg über eine fachmännische Schulung durch erfahrene Piloten, gewährleistet dies, und damit auch den Ruf unseres geliebten Hobbys.
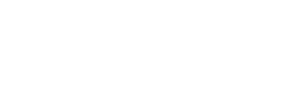
Anfänger?
Tipps für Anfänger – FAQs

Tipps für Neueinsteiger ins Thema Drohnen – Oft werden wir über unser Magazin angesprochen, angerufen und angeschrieben, mit welchem Modell und WIE man am besten ins Thema der Multirotor Welt startet. Grund genug endlich mal darüber zu schreiben. Wir schreiben aber nicht nur, wir bieten Euch eine Checkliste. Wie ist Euer Wissensstand, wie sind Eure Fähigkeiten rund um Modellbau, könnt Ihr schon fliegen… usw. All diese Fragen werden wir nun gemeinsam bearbeiten. Wir hoffen mit dieser kleinen Checkliste bereits einige Unklarheiten zu beseitigen und Euch den Einstieg leichter zu machen. Dieser Beitrag ist der erste Schritt in unsere Reihe der FAQs und Wissensbibliothek.
Welche Drohne eignet sich für Anfänger?
Diese Frage erreicht uns eigentlich nicht so häufig, merken aber in den Gesprächen das sich Einsteiger damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Es kommt ganz auf Eure Anforderung an. Wir empfehlen gerade zum Start allerdings immer einen Quadrocopter (4 Ausleger). Egal ob Ready-to-fly oder im Eigenbau. Aufbau, Konfiguration, Fehlerquellen, Empfehlungen.. all diese Dinge sind hier einfach etwas einfacher. Es gibt genug Anleitungen und Hilfestellungen. Bei speziellen Rahmensystemen sind spezielle Konfigurationen erforderlich und da wird es dann oft schon etwas tricky. Schwerpunkt Ermittlung, Lage des GPS oder Motor – & Propwahl um nur einige Faktoren zu nennen. Hier bedarf es einfach ein wenig Erfahrung.
- Für blutige Modellbau Anfänger ohne großes Budget empfehlen wir eigentlich immer kleine Modelle, die gut fliegen. Unsere Empfehlung war bislang der Minicopter von Reely, allerdings gibt es diesen nicht mehr und wir sind auf Hubsan X4 oder Jamara ausgewichen. Bei Preisen bis zu 50 EUR und guten Flugeigenschaften empfehlenswerte Modelle. Habt Ihr das Fliegen damit drauf, kann auf ein größeres Modell gespart werden. Die Flugeigenschaften und die Steuerung sind gleich! UPDATE: Mittlerweile kann ich den Blade Inductrix wirklich empfehlen. Fliegt großartig und lässt sich sogar auf FPV umbauen, wenn es spaßiger werden soll.
- Für Anfänger mit Budget und ohne Bastelwillen geht es dann in Richtung DJI Drohne mit Kamera. Je nachdem welches Budget vorhanden ist. Ob gebraucht oder Neu spielt dabei keine Rolle. Gute Gebrauchte sind wahre Schnäppchen. Über den Phantom schreibe ich jetzt hier nicht viel. Dazu könnt Ihr Euch hier unsere DJI Phantom Artikelreihe verinnerlichen. DJI Spark, Mavic Air oder DJI Mavic – es sind alles wirklich gute Modelle für Einsteiger bis zum Profi. Aktuell im Test: DJI Phantom 4 und die DJI Avata Alternativ als Hexacopter : Yuneec Typhoon H
- Für Anfänger mit Bastel-Erfahrung gibt eigentlich nur das Budget eine Grenze. In jedem Fall können wir hier als Flight Control (FC) eine NAZA empfehlen. Fliegt gutmütig, muss nicht programmiert werden und ist eben Plug n Play. Gerade das Thema Programmierung haben wir aus Euren Antworten oft als störend empfunden. Wer da richtig Spaß an der Technik hat, dem sei eine NAZE32 als Beispiel empfohlen. Rahmen, Motoren / ESC & Props könnt Ihr Euch nach Budget und Geschmack aussuchen. Wenn Ihr mit FPV durchstarten wollt, ist unser Bau eines FPV Racer Guide sicher spannend.
Was kostet mich eine Einsteiger Drohne?
Die wohl meist-gestellte Frage lautet : „Ich will einen Copter mit guter Kamera der gut fliegt – für 100 EURO. Was gibts da?“ Einfache Antwort… NIX! Es gibt einfach kein System das eine vernünftige Kamera für 100 EUR an Board hat! Fangt wie in der ersten Frage einfach an mit einem kleinen Minicopter zu üben und spart in Richtung DJI Phantom / Blade 350QX oder 200QX / Eigenbau und plant ein Budget ab mind. 400 EUR ein. Gute Gebrauchte gibt es schon ab 330 EUR. Da ist ne Funke bei, Ladegerät und Zubehör. Dann braucht Ihr noch ne ActionCam. Als Tipp. Eine günstige und gute Cam ist die easypix goxtreme .
Welche Formen gibt es?
Auch diese Frage wird uns interessanterweise sehr oft von Neulingen gestellt. Meist in Verbindung mit irgendwelchen verlinkten Youtube Videos. Die gängigsten Formen sind ohne Frage der Quadrocopter (4 Ausleger als X oder Kreuzform) und der Hexacopter (6 Ausleger). Neben den genannten Formen gibt es noch einige andere Varianten. Da wäre zum einen der klassische Heavylifter. Ein Oktocopter (8Ausleger) und zum anderen ein Y6 oder Tricopter. Die laufen Euch sicherlich häufiger über den Weg. Beim Tricopter ist ein Ausleger hinten und zwei Ausleger vorn. Dan gibt es noch Systeme als H Version für Kameraflüge. Und jede Kombination gibt es dann noch mit jeweils doppelten Motoren. So wird aus einem X quadrocopter schnell ein X8 – denn dieser fliegt dann mit 8 Motoren. Pro Ausleger wird hier ein Motor andersherum unten montiert. Die Rotoren drehen dann je Ausleger gegenläufig. Neben den Ausleger-Varianten gibt es dann noch verschiedenste Rahmentypen. Mal klein und kompakt, mal richtig groß. Als Kontrast-Beispiel nennen wir mal einen TBS Discovery, der sehr flach gebaut ist im Vergleich zum DJI Phantom. Diese Frage könnten wir jetzt ewig ausführen. Aber was es alles für Rahmen-Konzepte gibt, erfahrt Ihr schon nach und nach. Wenn Ihr da mehr wissen wollt, so lasst es uns doch bitte wissen. Und nicht wundern. Das Wort Quadrocopter hat sich irgendwie als Verallgemeinerung durchgesetzt. Oft ist von einem Quadrocopter die Rede ohne dabei auf die Anzahl der Motoren zu achten. Besser als das böse „D“ Wort – das könnt Ihr Euch direkt schenken. Wir fliegen keine Kriegsspielzeuge!
Und wo sind die Unterschiede der Modelle?
Im Grunde liegen die Unterschiede bei den Anforderungen, die Ihr Euch steckt. Für einfaches und schnelleres FUN Fliegen eignen sich kleine, flache Rahmen sehr gut. Für stabile Kameraflüge macht die Größe und Anzahl der Motoren den Unterschied. Gerade bei der Luftbildfotografie /Videografie bestimmt die Art und Größe der Kamera die Form. Eine GoPro kann jeder Copter tragen – eine RED Kamera nicht 😉 Umso schwerer die Kamera, umso höher die Anforderungen an Euren Copter. Bei Hobby Anforderungen ist die Bauform und Anzahl der Motoren eher eine Glaubens- und Geschmacksfrage.
Selber bauen oder fertig kaufen?
Das kommt komplett auf Eure Laune und Euer Gefühl an! Da können wir auch kein Muster erkennen. Der eine mag das basteln, der andere hasst es! Ich persönlich liege eher dazwischen. Ich liebes es zu basteln, aber eine komplizierte FC zu programmieren und mich mit Einstellflügen wochenlang zu quälen… nein Danke! Wenn Ihr also Spaß am Basteln habt, dann baut Euch Euer eigenes System! So schwer ist es auch nicht! Und wenn Ihr überhaupt kein Händchen dafür habt, aber gern einen Custom Copter haben wollt, dann schreibt uns doch mal! Wir kennen einen guten Einkaufs- und Bauservice!
Gebraucht kaufen?
Das Budget lässt einfach keinen vernünftigen Quadrocopter zu? Die Erfüllung des Traums des DJI Phantom 4 liegt in weiter Ferne? Es muss nicht immer neu sein! Klar, Garantie ist wertvoll und ein Neues Modell zu fliegen ist ein tolles Gefühl. Aber gerade der erste Copter kann durch eigenes Versagen schneller gen Boden sausen und dann tut es beim Gebrauchten vllt. nicht so weh! Wir können es Euch nur empfehlen. Kauft bei begrenztem Budget lieber was gutes Gebrauchtes als was schlechteres Neues!
Drohne mieten?
eine weitere sehr gute Möglichkeit für Anfänger ist, die Drohne zu mieten und zu schauen, ob sie den Anforderungen und Bedürfnissen etnspricht. Dies ist bei verschiedenen Anbietern möglich. Ich habe dir alles zum Thema Drohnen mieten in einem eigenen Artikel zusammengestellt.
Wo darf ich fliegen?
Das Thema haben wir hier behandelt: Was darf ich alles mit meinem Quadrocopter ?
Was brauche ich noch alles
Das kommt auf Euer gewähltes Setup an! Bei einem DJI Phantom braucht Ihr zum Start überhaupt nichts! Funke, Lipo, Ladegerät. Alles ist dabei! Was Ihr zum Fliegen generell neben dem Modell benötigt: Mind. 6 Kanal Fernsteuerung, Ladegerät für LiPo, Lipo Akkus.
Fliege niemals ohne eine Drohnen Haftpflichtversicherung. Unfälle können sehr viel Geld kosten und Du wirst nicht wirklich glücklich, wenn Du Dein Leben lang den Schaden aus eigener Tasche bezahlen musst. Auch hilft die Versicherung im Streitfall und trägt die Rechtskosten, denn sie haftet ja im Fall des Falles.
Ganz wichtig: Ihr braucht unbedingt eine Drohnen Versicherung
Jetzt wünschen wir Euch viel Erfolg bei dem Weg zum ersten Quadrocopter! Und bei Fragen, einfach melden 😉 Die Liste wird gerne erweitert. Das entscheiden auch Eure Fragen.
-

 Alle News9 Monaten ago
Alle News9 Monaten agoWohin steuert die Drohne? – 3 spannende zukünftige Einsatzbereiche
-

 Allgemein5 Monaten ago
Allgemein5 Monaten agoPräzise Vermessung von oben: Wie Drohnen die Landvermessung revolutionieren
-

 Allgemein5 Monaten ago
Allgemein5 Monaten agoINTERGEO Messebesuch: Auf Tuchfühlung mit der Zukunft der Drohnen- und Überwachungstechnik
-

 Allgemein3 Monaten ago
Allgemein3 Monaten agoVom Himmel ins Wohnzimmer: Drohnenaufnahmen als beeindruckende Leinwandkunst








